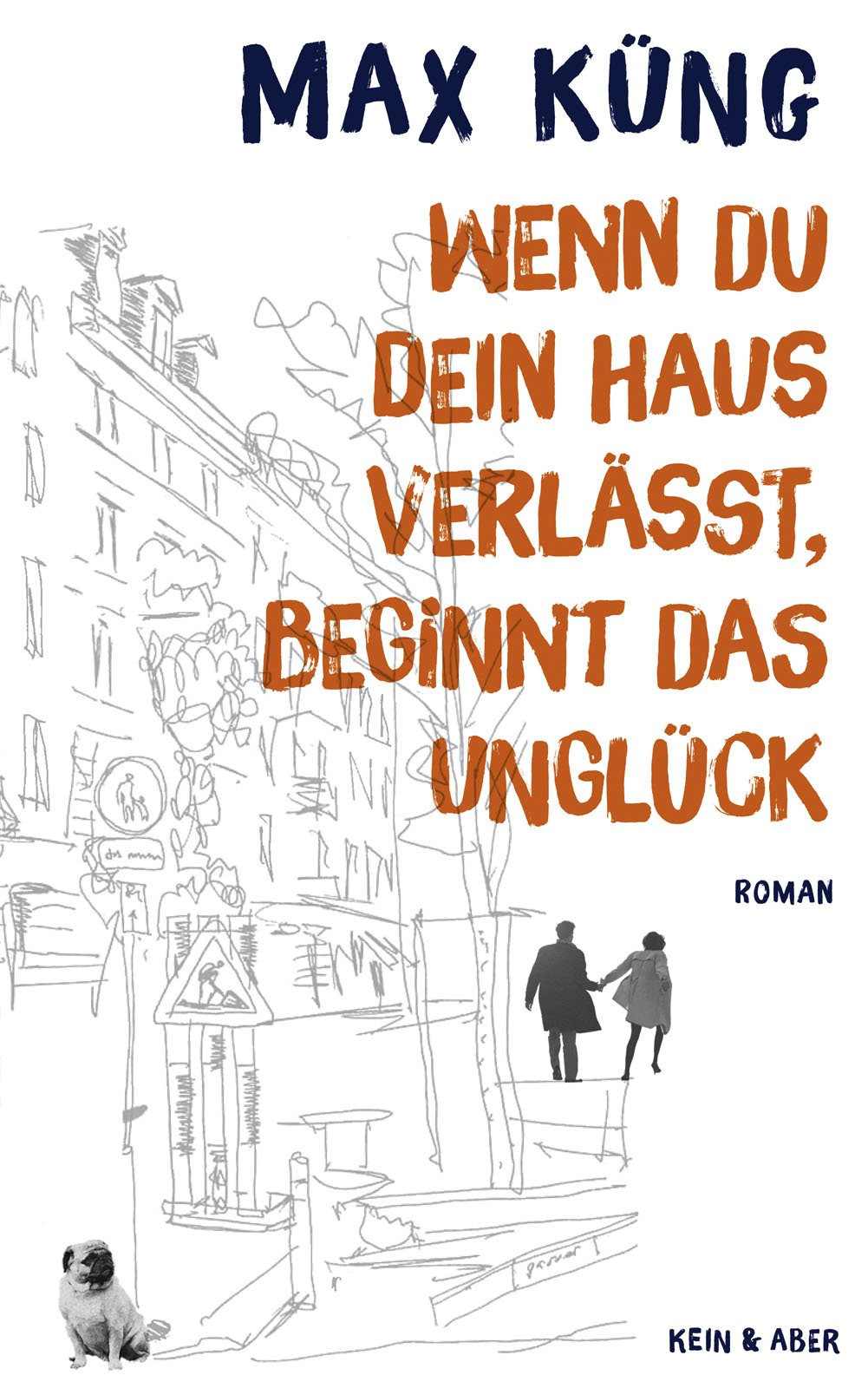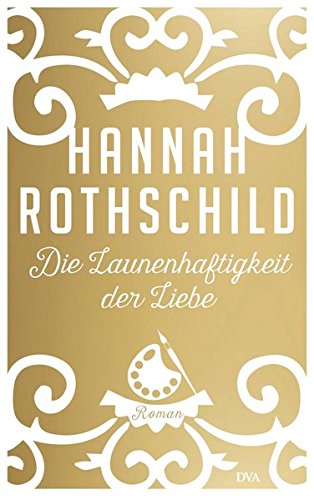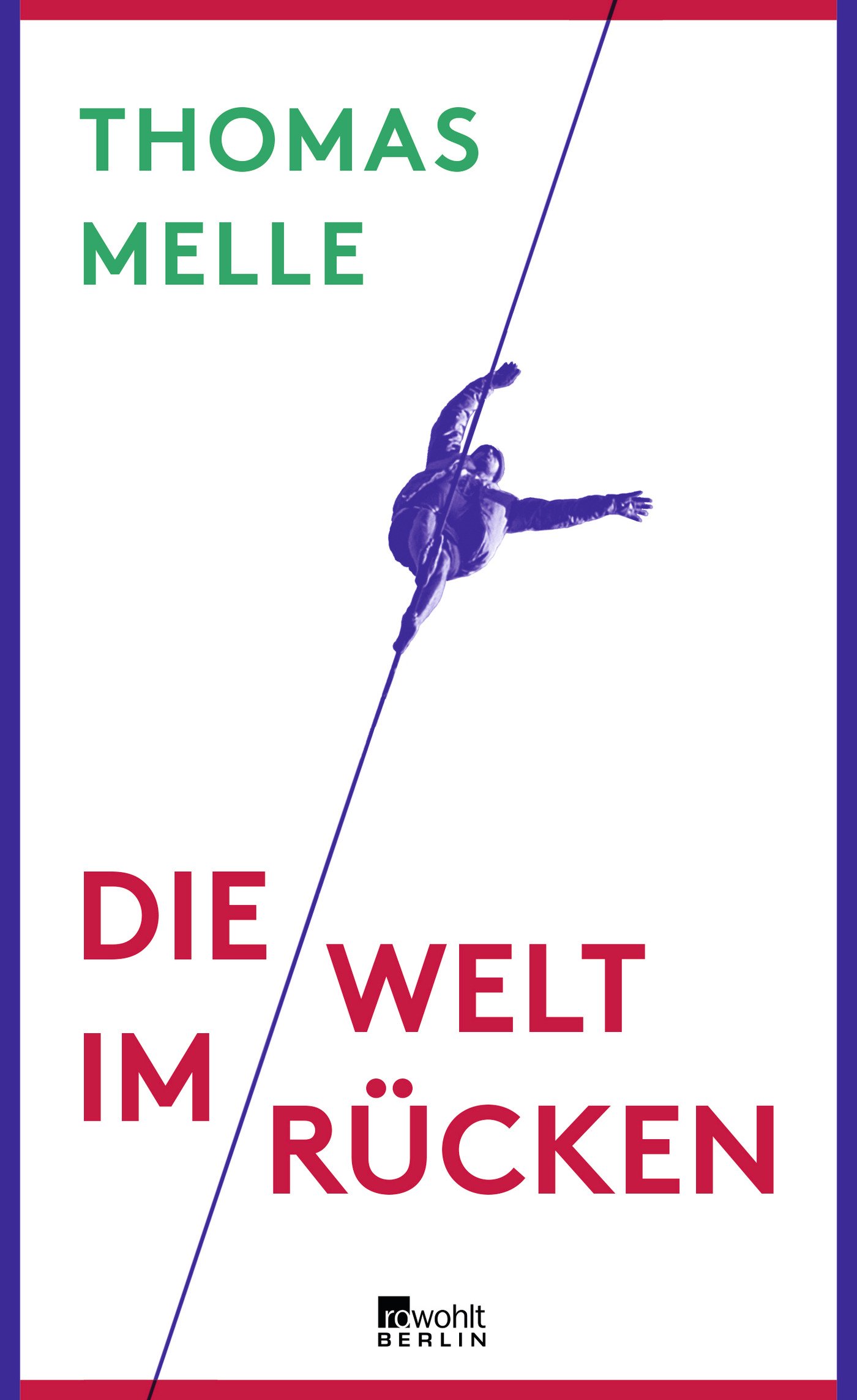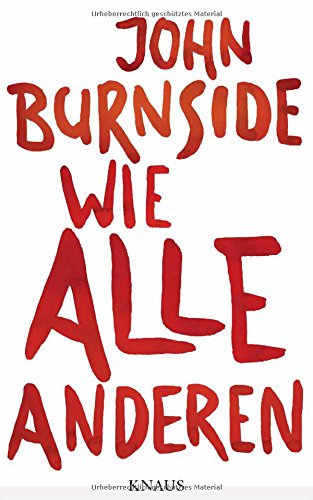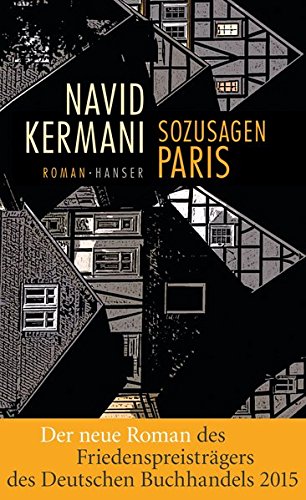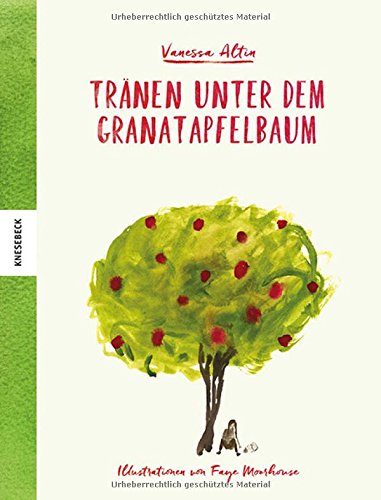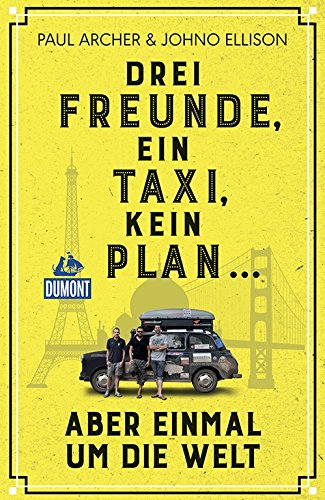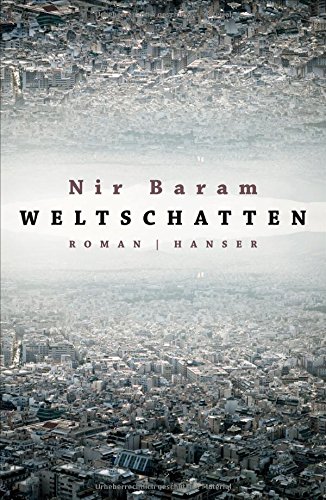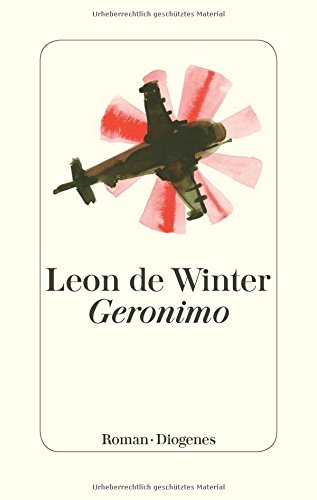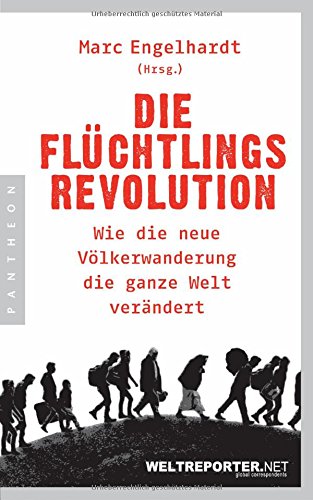Es fängt eher kurios an: mit einer Gurkenscheibe, dem Relikt eines Gin Tonics. Max Küng spannt seine Leser ganz schön auf die Folter, bis er zur Sache kommt – dem Haus, das entmietet werden soll. Die fünf Mietparteien, die um den Verbleib in dem Haus in der (fiktiven) Züricher Lienhardstraße bangen, skizziert er allerdings auch noch im Prolog, der wohl zeigen soll, wie das Kleinste mit dem Größten zusammenhängt. Die Geschichte ist schnell erzählt: Der Hausbesitzer möchte die Wohnungen sanieren und später teurer vermieten. Dagegen laufen die Mieter Sturm, und sie schließen sich – obwohl höchst unterschiedlich – zu einer Art Schicksalsgemeinschaft zusammen. Unter normalen Umständen würde den eitlen Moderator Tim Gutjahr und den glücklosen Immobilienmakler Fabio ebenso wenig verbinden wie die Kunststudentin Delphine und die Klatsch-Journalistin Paola oder die labile Alleinerziehende Virginia. Die drohende Kündigung wirkt wie eine Katharsis Doch die drohende Kündigung überwindet zunächst alle Schranken. Gemeinsam wird überlebt, wie man juristisch gegen die Kündigung vorgehen könnte. Ausgerechnet bei einer Unterredung unter den Männern öffnet Fabio einen Glückskeks mit dem Spruch „Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück“ – womit der Titel des Buches erklärt wäre. Doch das Unglück hat schon im Haus begonnen. Alle Bewohner stecken…
Hannah Rothschild kennt sich aus in der Welt der Reichen und der Kunst. Die 1962 geborene Autorin aus der berühmten Bankiersfamilie steht seit 2015 dem Aufsichtsrat der Londoner National Gallery vor – als erste Frau in der Geschichte des renommierten Hauses. Für ihr Romandebüt „Die Launenhaftigkeit der Liebe“ hat sie jahrelang recherchiert. Das merkt man dem Buch an, das immer wieder mit präziser Sachkenntnis überrascht. Viele Geschichten in einem Roman Dabei ist Rothschilds dickes Buch über die verschlungenen Wege eines Gemäldes und die Perfidie von Kunsthändlern weit mehr als ein Roman über Kunst, er ist auch Historien- und Kriminalroman und zudem eine Liebesgeschichte – und er bringt ein Gemälde zum Reden. Es ist Watteaus „Die Launenhaftigkeit der Liebe“, lang verschollen und nun unter dubiosen Umständen wieder aufgetaucht. Zur Versteigerung sind alle angereist, die auf dem Kunstmarkt Geld und Namen haben. Für das – fiktive – Gemälde eine Selbstverständlichkeit, hatte es doch zu seinen besten Zeiten Könige, Päpste und Mätressen erfreut: „Ich wusste, dass ich gerettet werden würde, aber nicht, dass es fünfzig Jahre dauern sollte. Es hätte Suchmannschaften geben müssen, Bataillone und Legionen. Warum? Weil ich unbezahlbar bin.“ Außerdem galt das so von sich überzeugte Gemälde als größte und bewegendste Darstellung…
Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Der Volksmund hat die Krankheit richtig erkannt. Die Betroffenen werden von einem Extrem ins andere katapultiert, von der Manie mit Höhenflügen und übersteigertem Selbstbewusstsein bis in die tiefste Depression mit Selbstmordgedanken. Der Begriff „bipolare Störung“ umschreibt nur unzureichend die oft extremen Ausschläge der Krankheit, die oft zur gesellschaftlichen Isolierung der Betroffenen führen. In seinem Buch „Die Welt im Rücken“, das auf der Shortlist des Buchpreises stand, beschreibt Thomas Melle ohne Rücksicht auf sich selbst, wie zerstörerisch die Krankheit wüten kann. Zwischen Wahn und Weltschmerz Er schildert die Manie, die ihm vorgaukelt, ein bedeutender Künstler zu sein, ja ein Weltenretter, dem die Umwelt mit Verehrung begegnet und der bei den Frauen leichtes Spiel hat. Auf die Umgebung wirkt er in dieser Zeit befremdlich hyperaktiv, ja selbstzerstörerisch. Er fühlt sich allem und jedem überlegen, und während er Freunde und Vorgesetzte beschimpft, die Wohnung zertrümmert und seine geliebten Bücher vernichtet, ergeht er sich in Allmachtsfantasien. Das macht ihn unerträglich für die anderen. Für ihn selbst aber wird erst die auf den Wahn folgende Depression unerträglich. Dann erkennt er das volle Ausmaß der Zerstörung, die er angerichtet hat, erkennt die absolute Leere seines Lebens und fällt in ein tiefes, schwarzes…
Er wollte immer anders sein als sein Vater. Das hat John Burnside auch geschafft. Immerhin ist der Schotte Schriftsteller geworden und lehrt als Professor kreatives Schreiben an der Universität von St. Andrews. Trotzdem ist er überzeugt davon, dass sein Vater nicht stolz auf den Erfolg gewesen wäre. „Er hätte gesagt: Das ist etwas für Weicheier, Bücher lesen und mit Studenten sprechen“, sagte der 61-Jährige in einem Interview. In dem Roman „Lügen über meinen Vater“ hat er mit dem alkoholkranken Stahlarbeiter abgerechnet, dessen Brutalität seine Kindheit überschattet hat. Die Fortsetzung heißt „Wie alle anderen“, und Burnside beschreibt darin, wie er selbst in den 1980er-Jahren drogensüchtig und alkoholabhängig war und zudem noch schizophren. Seltsame Höhenflüge – nah daran an der Selbstzerstörung Damals war sein größter Wunsch, wie alle anderen zu sein, also ein normales Leben zu führen – am besten in der Vorstadt und „aufs angenehmste betäubt“. Doch die Betäubung hält nicht an, er gerät wieder in den Sog der Abhängigkeit und fällt ganz tief, so tief, dass ein Kneipenbekannter ihn als Mörder seiner Frau engagieren will. Sein Leben wird zur Geisterbahn, heimgesucht von den Gespenstern der Vergangenheit. Er ist verliebt, hat Sex, reist und erlebt in selbst gewählter Einsamkeit seltsame Höhenflüge…
Sein Name wurde für den nächsten Bundespräsidenten ins Gespräch gebracht. Er wurde mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet und sprach auch schon im Bundestag. Es scheint, als habe uns Navid Kermani viel zu sagen. Das erwartete man auch von seinem neuen Roman „Sozusagen Paris“. Und da enttäuscht der Deutsch-Iraner, der sich als öffentlicher Intellektueller einen Namen gemacht hat. Der Autor macht im Geist die Begegnung zum Buch Der Roman erzählt vom enttäuschenden Wiedersehen mit der ersten Liebe und von der Entstehung eines Romans. Bei einer Lesung steht die „Schönste des Schulhofs“ plötzlich vor dem Autor. Er nennt sie Jutta und geht mit ihr nach Hause, wo beide in einem unaufgeräumten Wohnzimmer aber vor einer reich bestückten Bücherwand über die Vergangenheit reden, über Bücher und Paris, und wo der Schriftsteller schon darüber sinniert, wie er aus dieser Begegnung ein neues Buch machen und womit er die Bedenken seines Lektors zerstreuen wird. Die gemeinsame Nacht auf dem Sofa desillusioniert In dieser gemeinsamen Nacht auf dem Sofa passiert nichts, außer dass beide mit der Liebe abrechnen, deren erstes Feuer sich nicht mehr entzünden lässt. Womöglich auch, weil der Ehemann in der Wohnung anwesend ist, wahrscheinlicher aber, weil der Schriftsteller mehr Interesse an…
Im syrischen Aleppo tobt ein erbarmungsloser Krieg. Hunderttausende von Menschen sind eingeschlossen und hilflos den Bomben ausgeliefert. Doch während die ganze Welt auf diese gequälte Stadt starrt, ereignen sich in den Dörfern Dramen, bei denen ganze Familien ausgelöscht werden. Mit ihrem Roman „Tränen unter dem Granatapfelbaum“ will die Journalistin Vanessa Altin auf diese vergessenen Tragödien aufmerksam machen und denen eine Stimme geben, die längst voller Verzweiflung verstummt sind. Der Terror der Rattenmänner „Rattenmänner“ nennen die kurdischen Kämpfer die Männer vom IS, die den Bürgerkrieg in Syrien für ihre eigenen Zwecke nutzen und die Zivilbevölkerung terrorisieren. Das Mädchen Dilvan, Dilly genannt, ist mit ihren 13 Jahren eigentlich viel zu jung, um sich in den Kampf zu stürzen. Aber seit sie mit ansehen musst, wie ihre Mutter und ihre Schwester von den IS-Terroristen mit Stockschlägen auf einen Laster getrieben wurden und einer der Männer das Baby der Familie brutal zum Köpfen zerrte, kann sie nur mehr an Rache denken. Und daran, wie sie dabei helfen könnte, ihren Heimatort von den Rattenmännern zu befreien. Ihr großes Vorbild ist die mutige Kämpferin Rehana, die selbst hart gesottene IS-Krieger das Fürchten lehrt. Während gleichaltrige Mädchen in unseren Breiten vom neuesten iPhone träumen, träumt Dilly davon,…
„Im Laufe des letzten Jahres hatten wir an den unmöglichsten Orten übernachtet: an russischen Crack-Buden, auf Grünstreifen in Industrieanlagen oder auf Artilleriefeldern im Iran…“ Ja, die drei Jungs aus Großbritannien haben sich so manches getraut, wovon normale Touristen“ nicht mal träumen würden. Die Idee, mit einem Taxi um die Welt zu fahren, wurde nach einer alkoholgeschwängerten Nacht im Pub geboren, und Alkohol fließt auch auf der Fahrt mit dem altersschwachen London Black Cab, das die drei abenteuerlustigen Freunde Johno, Leigh und Paul auf den Namen Hannah taufen, immer wieder in Strömen. Zwei Guinness-Rekorde bei der Weltumrundung Dass sie es trotzdem schaffen, mit ihren Taxi auf einen der höchsten Punkte der Erde zu fahren, das Everest Basis Camp, brachte ihnen einen Guinness Record ein, den anderen gab es für die längste Taxifahrt der Welt. Wer das Buch, das aus der Weltumrundung entstanden ist, liest, wird den Dreien ihren Rekord wohl kaum streitig machen. Dass sie die Fahrten durch den Irak und Pakistan ebenso überlebt haben wie den mörderischen indischen Verkehr oder die Hitzerekorde in Australien, war pures Glück. Und nicht jeder möchte bei seiner Reise als Couchsurfer bei fremden Menschen auf dem Fußboden pennen, sich von Einheimischen einladen lassen oder wegen…
„In dem Augenblick, in dem du eine Idee in das trübe Wasser dieser Welt tauchst, wird sie, so phantastisch sie auch sein mag, besudelt.“ Von dieser Besudelung großer Ideen erzählt der Israeli Nir Baram in seinem ambitionierten Roman „Weltschatten“. Es geht um das große Ganze: die Auswüchse der Globalisierung, darum, wie alles zusammenhängt, um die unheilvollen Verflechtungen von Wirtschaft und Politik – und um das Ende der Ideale. Baram erzählt seine komplexe Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln und in drei Erzählebenen. Früher rabiat und rebellisch, später erfolgreich und korrupt Per E-Mail-Verkehr lässt er etablierte und längst korrumpierte Mitarbeiter einer weltweit agierenden Beraterfirma zu Wort kommen; in der dritten Person erzählt er von einem naiven Israeli, der in die Fallen des Großkapitals stolpert und im Kokon der Wohlhabenheit charakterlich verwahrlost. Und dann ist da noch ein namenloser Ich-Erzähler, der sich mit einer Gruppe von jungen Chaoten zusammengetan hat, die einen weltweiten Streik organisieren wollen. Rabiat und rebellisch wie sie waren früher einmal auch die Berater, doch die Saturiertheit hat sie blind gemacht für alles, was außerhalb ihrer Geschäfte liegt, auch für die Menschlichkeit – bis auf einen, der zum Whistleblower wird. Da ahnt man schon, wie die einzelnen Bauteile sich zu einem…
Er weiß, wie er seine Leser dran kriegt, auch wenn er ihnen eine hanebüchene Geschichte auftischt. Leon de Winter ist ein Meister der spannenden Erzählung, und dabei scheut er sich auch nicht, die Realität umzuschreiben. Das gilt besonders für seinen neuen Roman „Geronimo“. Doch diesmal treibt es der Niederländer zu bunt. Denn Winter wagt sich an die Weltgeschichte. Geronimo war das Codewort für die Aktion Bin Laden Geronimo lautete das Codewort für die Aktion Usama Bin Laden, bei der der Gesuchte ums Leben kam. Doch was wäre, wenn die Geschichte lügt? Wenn bin Laden überlebt hätte? Dank eines Komplotts? Das ist die Ausgangsbasis für de Winters Roman. Im Mittelpunkt steht der nicht mehr aktive Navy Seal Tom Johnson. Vorwiegend aus seiner Sicht erzählt Leon de Winter eine Geschichte um Verlust und Liebe, um Verrat und Verantworung, um die Macht der Musik und die Machtspiele der Politik. Zum Gradmesser der Menschlichkeit wird das Mädchen Apana, das über Bachs Goldberg-Variationen Glück erfährt und von den Taliban deswegen verstümmelt wird. Johnson, der Apana mit Bach vertraut gemacht hat, fühlt sich für sie verantwortlich. Aber auch einem anderen wächst die schöne Verstümmelte ans Herz: Usama bin Laden, der hier menschliche Züge zeigen darf, nimmt…
Beim ersten großen UN-Gipfel zum Thema Flucht und Migration diskutierten die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen über den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten. Die Themen Flucht und Integration haben nicht nur die Ergebnisse der Landtagswahl in Mecklenburg Vorpommern und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bestimmt, sind nicht nur Stammtischgespräche, sie beeinflussen auch den Tourismus und unsere Zukunft. „Wie die neue Völkerwanderung die ganze Welt verändert“ ist der Untertitel eines informativen Buches von Weltreporter.net, das sich mit der „Flüchtlingsrevolution“ in allen Erdteilen beschäftigt. Klar gestellt wird zunächst der Begriff „Flüchtling“ als „derjenige, der geht, obwohl er lieber bleiben würde“. Auch in den Traumzielen der Touristen sind Flüchtlinge Alltag Und mit solchen Flüchtlingen hat es die Welt auf allen Kontinenten zu tun, auch in den Traumzielen der Touristen: In Lateinamerika ebenso wie in Asien, in Australien wie in Kanada oder den USA. Keineswegs nur in Europa, wo die Weltreporter ein gefährliches Anwachsen der Fremdenfeindlichkeit registrieren aber durchaus auch viel Menschlichkeit schildern, die zu Hoffnung Anlass gibt: „Die Welt nach der Flüchtlingsrevolution kann eine solidarische Welt sein, eine gerechtere, eine vielfältigere, in der wir viele der Krisen von heute hinter uns gelassen haben werden.“ In den einzelnen Kapiteln begleiten die Weltreporter die Flüchtlinge…