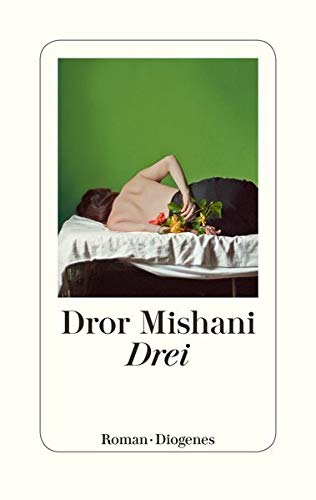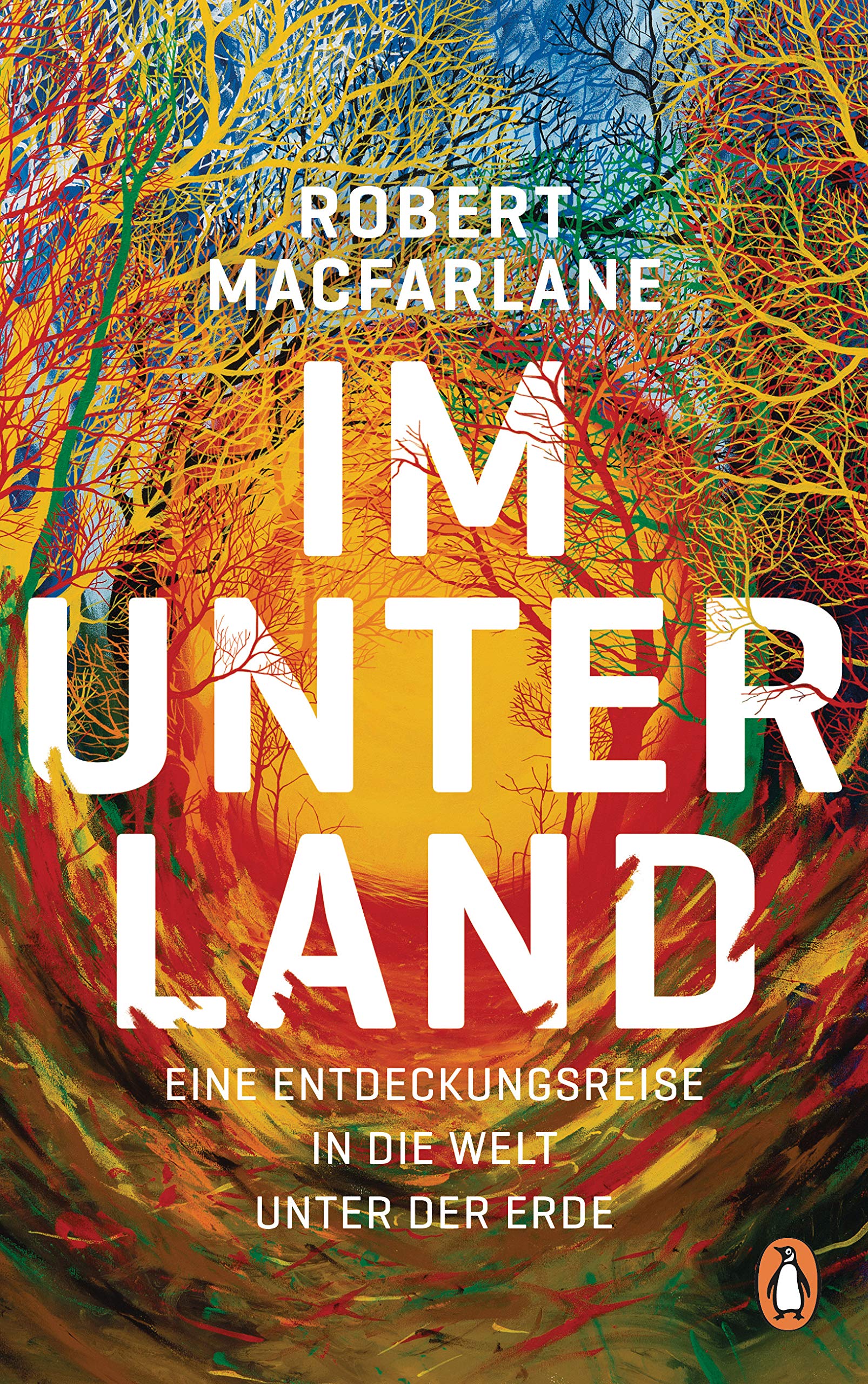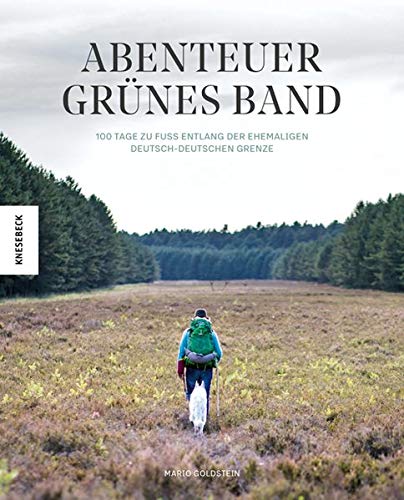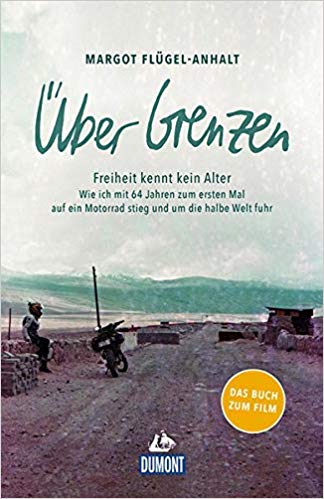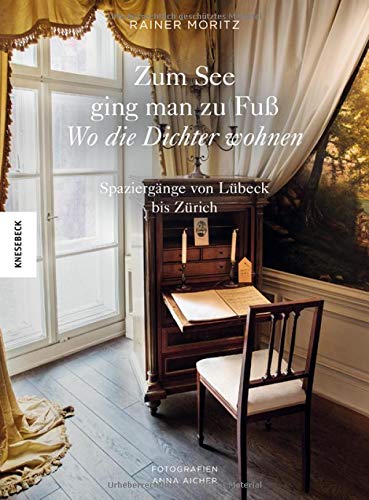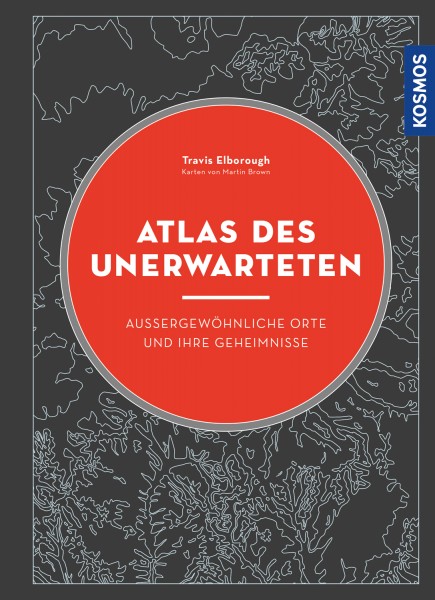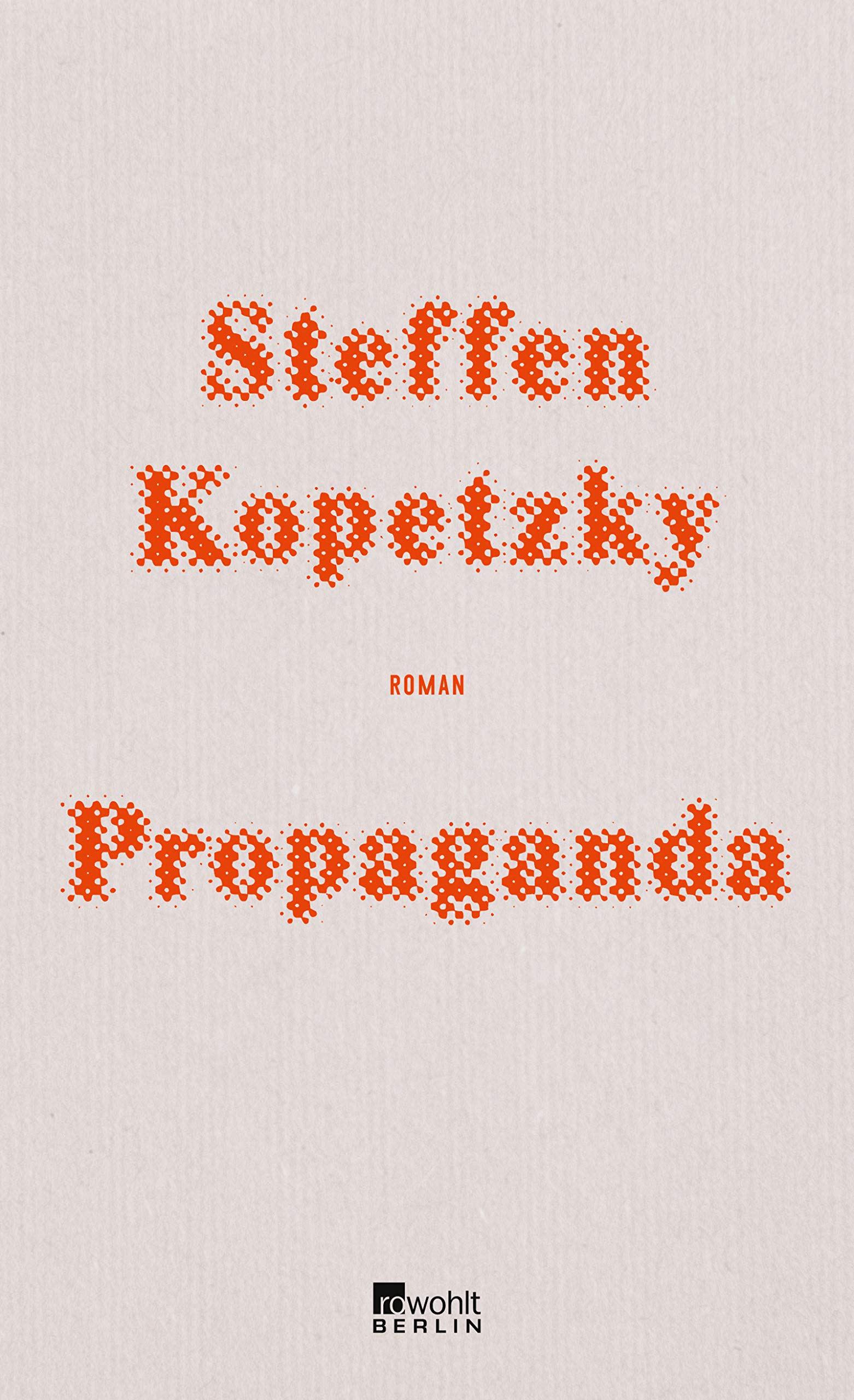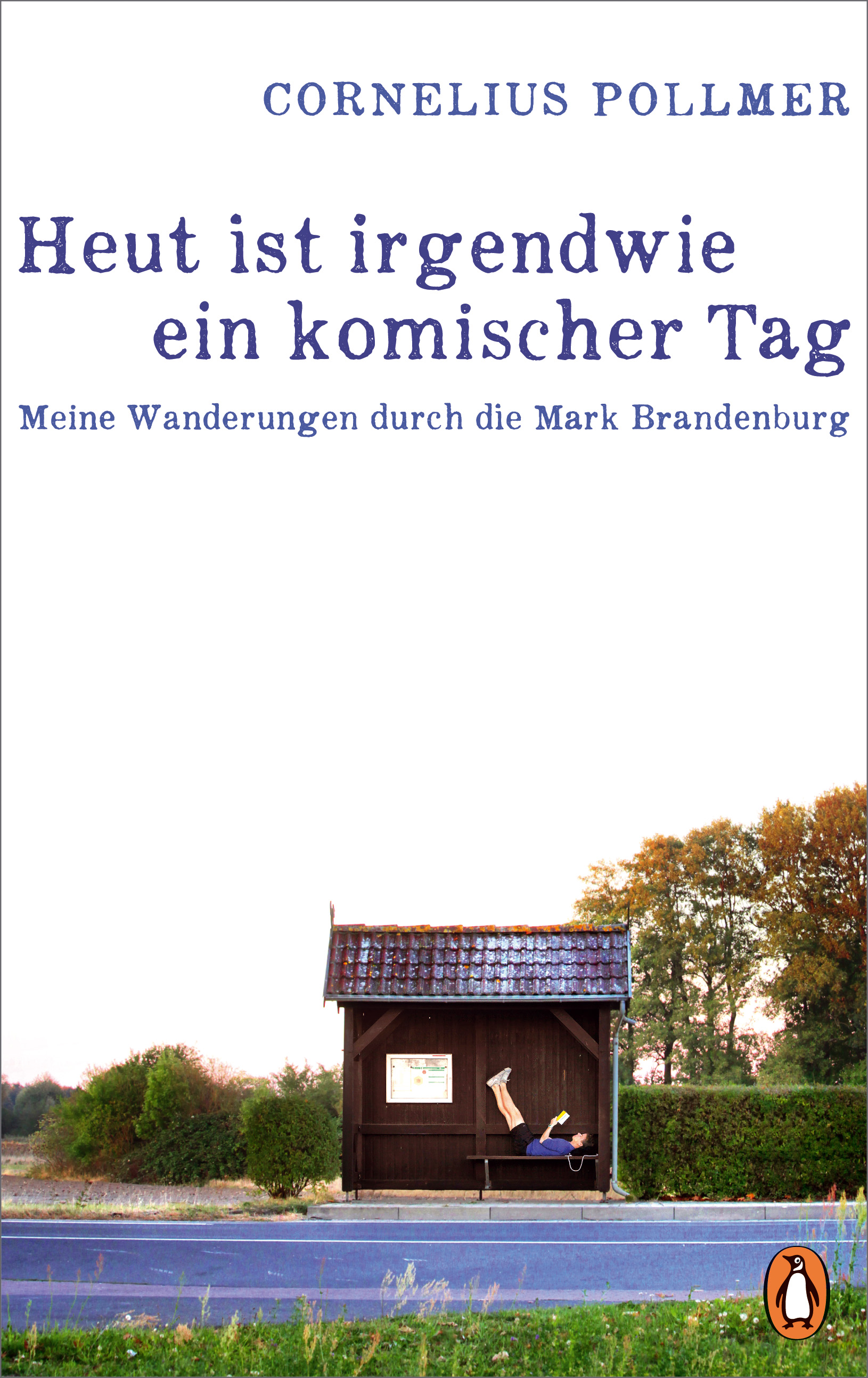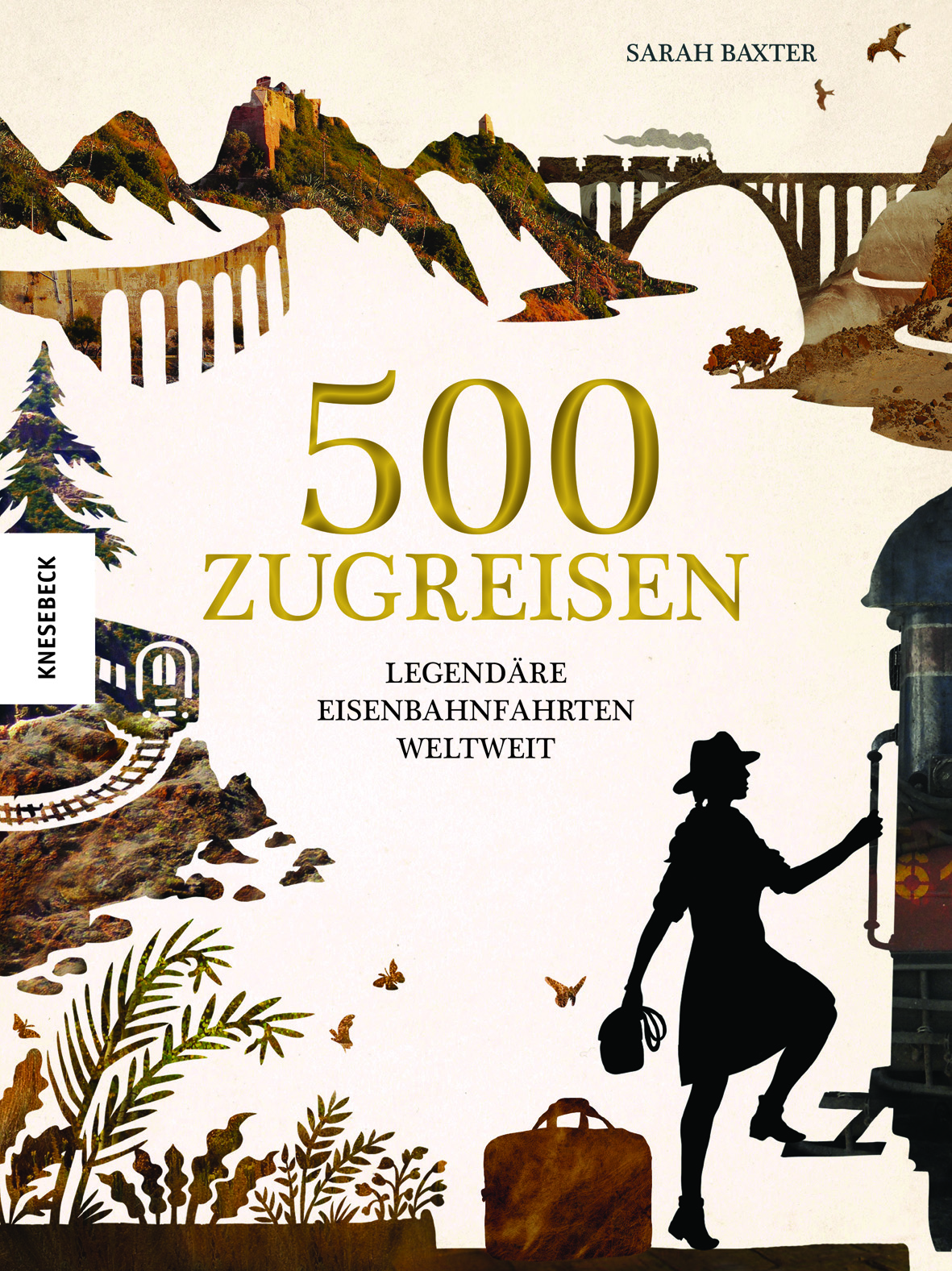Dror Mishani weiß, wie Spannung geht. Auch in seinem neuen Roman „Drei“, der gar nicht als Krimi firmiert. Was Orna fühlt, wird die Leser die nächsten 250 Seiten lang begleiten: „Die Angst, die ihr in jener Nacht die Kehle zudrückte, war so stark wie an dem Tag, an dem sie Gil mit seiner Frau begegnet war, und auch die Wut war dieselbe, was sie abermals denken ließ, dass sie auch an jenem Tag im Grunde auf Ronen böse gewesen war und nicht auf Gil; dass auch ihre Beklemmung nicht unmittelbar mit Gil zusammenhing und damit, dass er sie belogen hatte, sondern mit dem, was diese armselige Beziehung über ihr Schicksal und ihr Leben besagte.“ Die Erwartungen sind nicht allzu hoch Orna ist frustriert, seit ihr Mann Ronen sie und ihren Sohn Eran für eine Frau verlassen hatte, die eigene Kinder mit in die Verbindung brachte. In Gil hatte sie gedacht, einen Ersatz zu finden. Der Mann sieht zwar nicht besonders gut aus, ist auch nicht besonders charmant, aber zuverlässig und eher unaufdringlich. Durchschnitt eben, ein Mann für jeden Tag. Aber was konnte eine Frau wie Orna denn schon erwarten? Frauen voller Lebenshunger In drei Kapiteln erzählt der israelische Autor Dror…
„Seit jeher vertrauen wir dem Unterland an, was wir fürchten und loswerden wollen und was wir lieben und bewahren wollen“, stellt Robert MacFarlane im Eingangskapitel zu seinem großartigen Buch „Im Unterland“ fest. In drei „Kammern“ nimmt der ausgezeichnete Literaturwissenschaftler und Naturschriftsteller die Leser mit auf die Reise in unterirdische Gefilde. Reise über drei Kammern ins Unterland Zunächst in seiner Heimat Großbritannien in stillgelegte Bergwerke, zu Forschern, die sich mit der dunklen Materie beschäftigen, und ins Unterholz, zum Netzwerk von Bäumen und Pflanzen. Dann in Europa zu unterirdischen Städten, zu den Katakomben von Paris, in die Kanalisation, wo Obdachlose hausen und in slowenische Abgründe der Partisanenzeit. Die dritte Kammer schließlich ist dem Norden vorbehalten: den Höhlen aus der Urzeit, dem Kampf gegen die Ölbohrungen in Naturschutzgebieten, dem schmelzenden grönländischen Eis, den Grabkammern radioaktiver Abfälle auf der finnischen Insel Olkiluoto. Die Hinterlassenschaften unserer Zivilisation MacFarlane, eigentlich ein begeisterter Höhenbergsteiger, hat sich körperlich und seelisch viel zugemutet, um die Leser teilhaben zu lassen an seinen Exkursionen in die Unterwelt, die hin und wieder tatsächlich an die biblische Hölle erinnert. Er ist hinabgestiegen in enge Räume, die ihm die Luft zum Atmen nahmen, hat sich im Norden dem Wüten der Natur ausgesetzt und ist…
Der Kolonnenweg „zwingt einem förmlich ein langsames Fortbewegen auf“, stellt Mario Goldstein schon bald fest, nachdem er sich auf den langen Weg über das Grüne Band gemacht hat. Der in der ehemaligen DDR geborene Abenteurer, der selbst eine Fluchtgeschichte hinter sich hat, erkundet zu Fuß mit seiner Hündin Sunny den Todesstreifen, der zum Rückzugsort für viele Tierarten wurde und den nicht nur der Bund Naturschutz als Ganzes unter Schutz gestellt sehen will. Bislang sind es 75 Prozent der 1400 Kilometer, die sich Mario Goldstein auf seiner langen Wanderung als „Erinnerungslandschaft“ präsentieren. Die Natur hat die Grenze überwunden 30 Jahre nach dem Fall der Mauer hat zumindest die Natur die Grenze überwunden. Wo einst 44 000 bewaffnete Soldaten dafür sorgten, dass das Schussfeld frei lag und möglichst kein Grashalm „das Licht der Welt erblickte“, 20 1,3 Millionen Landminen die Grenze zur Todesfalle machten, wo Dörfer geschleift und Flüchtige erschossen wurden, entwickelte sich mit den Jahren der Biotopverbund Grünes Band, der nicht nur Ornithologen, Tierfreunde und Naturschützer begeistert. Wolf und Luchs sind zurück, Otter, Schwarzstorch, Teichfledermaus und Rotbauchunke. In zwei Etappen auf dem Kolonnenweg Auch wenn das Wandern auf dem oft zugewachsenen Kolonnenweg „manchmal vor allem Plackerei“ ist, auch wenn nach langen…
Lange hat Margaret Atwood die Leser auf diese Fortsetzung warten lassen. Über die Jahre haben sich gefragt, wie es Desfred, der Protagonistin aus „Der Report der Magd“ geht. Ob sie Gilead überlebt hat, diesen totalitären, christlich-fundamentalistischen Staat, in dem Frauen nichts und Männer alles sind. Nun, nachdem ihr Buch durch IS und einen Frauen verachtenden Trump neue Aktualität bekommen und zugleich als Serie reüssiert hat, hat sich Atwood zu einer Fortsetzung veranlasst gefühlt, in der sie die offenen Fragen beantworten lässt – von den „Zeuginnen“, drei sehr unterschiedlichen Frauen. Die Leichen im Keller Die eine, Agnes, wächst in Gilead behütet in einem Kommandantenhaushalt auf, bis ihre „Mutter“ stirbt und die Stiefmutter die 13-Jährige zur Heirat freigibt. Die andere, die rebellische Daisy, lebt in Kanada bei politischen Aktivisten, die sich für die Flüchtlinge aus Gilead engagieren und durch eine Autobombe ums Leben kommen. Und die Dritte, Tante Lydia, ist als Chefin der „Tanten“ im Haus Ardua, einer Art Frauen-Disziplinierungs-Lager, mitten drin und nah dran an der Diktatur von Gilead: „Über die Jahre habe ich viele Leichen in den Keller gebracht, nun bin ich geneigt, sie wieder an Tageslicht zu holen – und sei es nur zu deiner Erbauung, mein unbekannter Leser.“…
Eine Frau, ein kleines Motorrad und eine Reise: Über Grenzen heißt das Buch, das Margot Flügel-Anhalt über ihr großes Abenteuer geschrieben hat. „Die sprachlose Aufmerksamkeit der Männer überrascht und amüsiert mich immer wieder. Ich bin eine ältere Frau. Ja. Ich fahre Motorrad. Ja. Na und?“ Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen musste erst 64 Jahre alt werden, ehe sie sich zum ersten Mal auf ein Motorrad zu steigen traute. Und dann fuhr sie gleich los – aus einem Kaff in Nordhessen in die Länder Zentralasiens, die der Großteil der Deutschen höchstens aus den Nachrichten kennt: Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan… Die alte Frau und das Motorrad Eine Frau auf einer kleinen Enduro, auch Reisemoped genannt, ist in solchen Ländern schon eine Sensation und dann noch eine ältere Frau. Doch Flügel-Anhalt lässt sich nicht beirren, auch nicht von einigen Stürzen, die ganz und gar nicht harmlos sind. Und schon gar nicht von unfreundlichen Zöllnern an der Grenze oder Männern, die sich weigern, einer Frau die Hand zu geben. Die Frau ist tough, sie braucht keine männliche Stütze – auch wenn sie manchmal ganz froh ist über hilfsbereite Begleiter. Auf einem Teil der Reise fahren zwei Filmer mit. Die Herausforderung des Wegs Doch…
Rainer Moritz weiß, dass Schriftsteller aus ihrer Umgebung – dem Umfeld, den Mitmenschen – schöpfen , auch wenn es lange verpönt war, darüber zu reden. Nun hat der versierte Literaturkritiker und -Liebhaber einen ebenso schönen wie lesenswerten Bildband zur Verortung von Literatur veröffentlicht. „Zum See ging man zu Fuß – Wo die Dichter wohnen“ lädt dazu ein, bekannte Schriftsteller wie Kafka und Hauptmann, Thomas Mann und Anna Seghers, Hesse und Schnitzler in ihrem Lebensumfeld kennen zu lernen und zugleich die Orte neu zu entdecken. Das Ortsbild von Travemünde Moritz ist ein wacher Beobachter, der in der Geschichte Bescheid weiß, aber auch die Realität der Gegenwart im Auge behält. So weist er bei Thomas Mann nicht nur darauf hin, dass das Buddenbrookhaus erweitert wird und mit zeitgeistigen Inszenierungen aufwarten soll, er spart auch nicht mit Kritik an den Errungenschaften der Moderne wie in Travemünde: „Kaum woanders ist es geglückt, mit einem einzigen Neubau ein Ortsbild so nachhaltig zu beschädigen.“ SUVs und Selfiestangen Der Autor registriert die SUVs vor dem Wohnhaus Schnitzlers in der Wiener Sternwartstraße und die Warteschlangen vor dem Kaffeehaus Central, die Besuchermassen in Prag und die „hochgereckten Selfie Stangen im Goldenen Gässchen“, auch die Touristen beim Tätscheln der Pessoa-Statue…
In der Einführung zu seinem Atlas des Unerwarteten würdigt Travis Elborough die Leistung des herzoglichen „Kosmografen“ Mercator, von dem im Frühjahr 1595 der „Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi“ erschien. Ein Werk mit 107 Karten, das trotz aller Genauigkeit doch nicht wie im Titel versprochen die „Struktur der ganzen Welt“ darstellte. Einige Karten fehlten ganz, andere waren wohl der Fantasie des Kartographen entsprungen. Mit seinem „Atlas des Unerwarteten“ knüpft Elborough an Mercators Atlas an und nimmt die Leser mit auf eine Reise zu 45 seltsamen oder erstaunlichen Orten, die per Zufall oder auch unbeabsichtigt entdeckt wurden. Titusville und Vaseline Zu all diesen Orten gibt es in dem schön gestalteten Buch eigens dafür angefertigte Karten, Schwarz-Weiß-Fotografien und eine geistreiche, oft spannende Geschichte. Zum Beispiel zur Wiederentdeckung der Insel Madeira, die einem Unwetter und einer unglücklichen Liebesgeschichte zu verdanken ist. Zu Titusville, dem längst vergessenen Geburtsort der Vaseline. Natürlich gehört auch Pompeji zu den durch Zufälle wieder entdeckten Orten oder Qumran am Toten Meer, wo Hirten die berühmten Schriftrollen als Erste entdeckten. Chess City und Nova Huta Ganz seltsam ist die Geschichte von Freshkills Park in New York, einstmals „ein natürliches Feuchtgebiet, in dem Stelzvögel und blaue Krabben lebten und Wildkräuter…
Steffen Kopetzky legt mit „Propaganda“ ein ehrgeiziges Anti-Kriegs- Epos vor, in dem er zwei amerikanische Kriegseinsätze miteinander koppelt. Bindeglied ist ein Weltkriegs- und Vietnamveteran. Ein Kriegsversehrter, der weiß, was Napalm anrichten kann und der sich seit einer Begegnung mit dem Gift buchstäblich in seiner amerikanischen Haut nicht mehr wohl fühlt. John Glueck heißt der Mann, der sich wegen eines Verkehrsdelikts verhaften und einsperren hat lassen. Die Hölle im Hürtgenwald Glück hatte der Mann in seinem Leben auch – immerhin hat er überlebt – aber vor allem jede Menge zu erzählen. Er war dabei bei einer der schlimmsten Niederlagen der Army im Hürtgenwald und ist 1971 aktuell in die Publikation der brisanten Pentagon Papers verwickelt, die den Amerikanern grausame Wahrheiten über den Vietnamkrieg bescheren. Jetzt also sitzt der Held im Knast und schreibt sein Leben auf. Er hat mit Salinger und Bukowski bei einem Creative Writing Kurs die Schulbank gedrückt und gesoffen, und er trinkt mit dem genialen Säufer Hemingway im Hürtenwald gegen die Angst – und dessen Schreibblockade – an. Amerikanische Propaganda gegen die Nazis Vor allem aber ist Glueck als Abkömmling deutscher Auswanderer vernarrt in die deutsche Kultur. Deshalb übernimmt er im Krieg gegen die Nazis den Job, die…
Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg umfassen fünf Bände. Für seine Wanderungen auf den Spuren Fontanes unter dem Titel „Heut ist irgendwie ein komischer Tag“ hat Cornelius Pollmer gerade mal 235 Seiten gebraucht. „Fontane reloaded“, wie es der Buchumschlag suggeriert, ist also ein bisschen hoch gegriffen. Der junge Journalist hat auch nicht Schlösser und Kirchen beschrieben oder sich dem kulturhistorischen Hintergrund gewidmet. Ihn interessierte nicht das Gestern, sondern das Heute. Originale und Landjugend Und da waren es vor allem die Menschen, die Pollmer faszinierten. Ausgiebig beschreibt er Originale wie Schniepa, den unentwegt quasselnden und organisierenden Truck-Kapitän, oder Krafft Freiherr von Knesebeck, einen Wessi mit erstaunlichem „Regionalimperium“, zu dem auch ein Hundehotel gehört. Und dann natürlich die Landjugend um Troppi, die feste feiern kann und sich auch im Suff noch der Heimat verbunden fühlt. Sommerleichte Aufzeichnungen „Das Geschehen auf Wanderungen kann ein ganz und gar innerliches sein, eine Instrospektion zu allen möglichen Fragen des Lebens,“ schreibt Pollmer zwischendrin, „So wandert man äußerlich durch die Gegend und innerlich durch sich selbst und alles schwingt in einem idealerweise sommerleichten Gefüge.“ Sommerleicht sind auch seine Aufzeichnungen, manchmal vielleicht ein bisschen zu leicht oder eher rotzig, wenn die Sonne „so erbarmungslos feuert, dass allen langsam,…
Die Faszination Eisenbahn ist von der ersten Seite an spürbar, und sie zieht sich durch alle sechs Kapitel und alle 400 Seiten. Die Weltreisende Sarah Baxter stellt die Züge als Zeitmaschine vor und beginnt ihre Reise durch die Geschichte der Menschheit anhand von Eisenbahnstrecken in der Urgeschichte. Das letzte Kapitel widmet sich dem modernen Streckenbau und der Rückbesinnung auf eine lange Tradition. Von Namibia bis Tschernobyl Ganz so schlüssig ist das Konzept allerdings nicht, auch wenn zu manchen Strecken Geschichtliches erzählt wird. Vordergründig geht es vor allem darum, interessante und spektakuläre Strecken vorzustellen, wobei nur ein Bruchteil mit einer ausführlichen Beschreibung, Karten und Bildern aufwarten kann. Nummer 1 ist der Wüsten-Express in Namibia, der auf einem Eisenbahnnetz aus der Zeit des deutschen Kaiserreichs unterwegs ist. Nummer 494, das letzte große Porträt, beschreibt die Strecke Owrutsch-Tchernihiw, zu der bis zum GAU 1986 auch Tschernobyl gehörte. Heute fahren die Züge bis Slawutytsch, das für die Menschen gebaut wurde, die aus der radioaktiv verseuchten Zone evakuiert werden mussten. Von hier führt ein Abschnitt zur neuen Endstation Semikhody in der 10-km-Sperrzone um Tschernobyl. Höhlenbahn und höchste Eisenbahn der Welt Es sind also höchst unterschiedliche Züge und Strecken, die das Buch vorstellt. Auch Schmalspur- und…